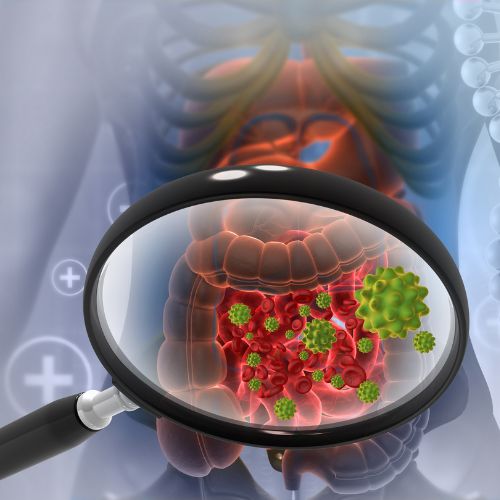Lesezeit: 5 Minuten Inhaltsverzeichnis: Darum ist eine gesunde Darmflora wichtig…
Übergewicht bei Kindern – ein fundierter Überblick
Lesezeit: 7 Minuten
 In den letzten Jahrzehnten nimmt das Thema „Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen“ zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit ein – sowohl als Gesundheitsrisiko von heute als auch als Präventionsaufgabe für morgen. Denn klar ist: Übergewicht und Fettleibigkeit ist schon längst kein reines „Erwachsenenproblem“. Im Folgenden beleuchten wir das Thema umfassend: Wir stellen aktuelle Statistikdaten vor, analysieren Ursachen und gehen darauf ein, ab wann man von Adipositas spricht. Dazu betrachten wir auch mögliche Folgeerkrankungen und zeigen auf, welche Handlungsmöglichkeiten Eltern haben – mit Blick auf Ernährung, Bewegung und Prävention.
In den letzten Jahrzehnten nimmt das Thema „Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen“ zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit ein – sowohl als Gesundheitsrisiko von heute als auch als Präventionsaufgabe für morgen. Denn klar ist: Übergewicht und Fettleibigkeit ist schon längst kein reines „Erwachsenenproblem“. Im Folgenden beleuchten wir das Thema umfassend: Wir stellen aktuelle Statistikdaten vor, analysieren Ursachen und gehen darauf ein, ab wann man von Adipositas spricht. Dazu betrachten wir auch mögliche Folgeerkrankungen und zeigen auf, welche Handlungsmöglichkeiten Eltern haben – mit Blick auf Ernährung, Bewegung und Prävention.
Inhaltsverzeichnis
- Statistik für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht
- Was verursacht Übergewicht bei Kindern?
- Energieaufnahme vs. Energieverbrauch
- Genetische und familiäre Faktoren
- Frühere Lebensphasen spielen eine Rolle – Einflüsse von Geburt bis Vorschulalter
- Umwelt- und verhaltensbezogene Faktoren
- Welche Risikofaktoren gibt es bei übergewichtigen Kindern?
- Gesundheitliche Risikofaktoren
- Psychische und soziale Risikofaktoren
- Ab wann ist ein Kind adipös (fettleibig)?
- Folgeerkrankungen im Überblick
- Was können Eltern gegen das Übergewicht bei Kindern tun?
- Ernährung
- Bewegung
- Prävention
- Fazit zu Übergewicht bei Kindern
Statistik für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht
Zunächst ein Blick auf die Zahlen – sowohl international als auch spezifisch für Deutschland.
- Weltweit ist der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher stark gestiegen. Laut UNICEF gilt bei Kindern im Alter von 5 bis 19 Jahren Übergewicht als ein BMI-Wert über einer Standardabweichung über dem Median – und Adipositas als über zwei Standardabweichungen.
- Weltweit: Etwa jeder fünfte Jugendliche im Alter von 5 bis 19 Jahren ist übergewichtig; rund jeder zehnte gilt als adipös.
- In Deutschland zeigen Daten: Bei den 3- bis 17-Jährigen sind laut Robert‑Koch‑Institut (RKI) 9,5 % übergewichtig und 5,9 % adipös.
- Laut der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (PEB) sind z.B. bei 7-jährigen Jungen in Deutschland etwa 7,8 % übergewichtig, bei 7-jährigen Mädchen 7,2 %.
Diese Zahlen zeigen: Übergewicht und Adipositas bei Kindern sind auch in Deutschland relevante Probleme – und sie variieren je nach Alter, Geschlecht und sozio-ökonomischem Hintergrund.
Was verursacht Übergewicht bei Kindern?
Die Ursachen von Übergewicht bei Kindern sind vielfältig und meist das Ergebnis eines Zusammenspiels von diversen Faktoren, darunter den genetischen, familiären, umweltbedingten und verhaltensbezogenen.
Energieaufnahme vs. Energieverbrauch
Ein zentrales Prinzip lautet: Wenn Kinder, ebenso wie Erwachsene, langfristig mehr Energie (Kalorien) aufnehmen, als sie verbrauchen – etwa aufgrund zu häufiger, energiereicher Mahlzeiten oder zu wenig körperlicher Aktivität –, steigt das Risiko für Übergewicht. Sicherlich muss bei Kindern dabei beachtet werden, dass sie sich im Wachstum befinden und einen anderen Bedarf haben. Ab wann gilt ein Kind also als übergewichtig und wann handelt es sich noch um „Babyspeck“?
Genetische und familiäre Faktoren
Ein besonders starker Einflussfaktor auf das Gewicht eines Kindes ist die Familie – sowohl genetisch als auch in Bezug auf Lebensweise und Gewohnheiten. Kinder wachsen in einem Umfeld auf, in dem Ernährung, Bewegung, Schlaf und der Umgang mit Gesundheit geprägt werden. Diese früh erlernten Muster begleiten sie häufig ein Leben lang.
Zahlreiche Studien zeigen, dass das Risiko für Übergewicht bei Kindern deutlich steigt, wenn ein oder beide Elternteile übergewichtig oder adipös sind. Forscher schätzen, dass zwischen 40 % und 70 % der Gewichtsentwicklung genetisch beeinflusst werden kann. Das bedeutet nicht, dass Übergewicht unausweichlich vererbt wird – aber die genetische Veranlagung kann mitbestimmen, wie leicht oder schwer ein Kind Gewicht zunimmt oder wieder abnimmt.
Dabei spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle:
- Stoffwechselveranlagung: Einige Kinder verbrennen Kalorien langsamer oder haben ein stärkeres Hungergefühl.
- Appetit- und Sättigungsregulation: Genetische Varianten beeinflussen Hormone wie Leptin und Ghrelin, die das Hunger- und Sättigungsgefühl steuern.
- Fettverteilung und Energieverwertung: Manche Kinder speichern Fett effizienter – was in Zeiten von Überfluss zum Nachteil werden kann.
Dennoch gilt: Gene allein sind nicht der Hauptgrund, sondern sie erhöhen nur die Anfälligkeit. Erst wenn ungünstige Umweltfaktoren – wie zu wenig Bewegung oder ungesunde Ernährung – hinzukommen, manifestiert sich das Risiko. Daher sprechen Fachleute von einer „genetischen Prädisposition mit Umwelttrigger“.
Neben genetischen Faktoren spielt das familiäre Verhalten eine entscheidende Rolle. Kinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung – Eltern sind daher ihre wichtigsten Vorbilder. Wenn Eltern also regelmäßig zu energiereichen, zuckerhaltigen oder fettigen Lebensmitteln greifen, übernehmen Kinder dieses Verhalten häufig unbewusst. Auch Essensrhythmen – etwa das Auslassen des Frühstücks oder häufiges Snacken zwischendurch – werden übernommen.
Gemeinsame Mahlzeiten fördern nicht nur das Familiengefühl, sondern ermöglichen Eltern auch, gesunde Essgewohnheiten vorzuleben. Kinder, die erleben, dass frische Lebensmittel, Obst und Gemüse selbstverständlich sind, entwickeln langfristig ein gesünderes Ernährungsverhalten. Bewegung wird ebenfalls in der Familie gelernt. Wenn Eltern regelmäßig spazieren gehen, Fahrrad fahren oder Sport treiben, werden Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls aktiv. Familien, die gemeinsame Outdoor-Aktivitäten pflegen, fördern Bewegung ganz natürlich im Alltag. Umgekehrt kann ein sitzender Lebensstil – viel Fernsehen, wenig Aktivität – unbewusst auf die Kinder übertragen werden.
Frühere Lebensphasen spielen eine Rolle – Einflüsse von Geburt bis Vorschulalter
Übergewicht beginnt oft nicht erst im Schulalter. Die Weichen werden bereits in den ersten Lebensmonaten gestellt. Ein hohes Geburtsgewicht (über 4000 g) oder eine übermäßige Gewichtszunahme in den ersten Lebensjahren gelten als Risikofaktoren für späteres Übergewicht.
Kinder, die früh sehr schnell wachsen oder „auf Vorrat“ gefüttert werden, entwickeln häufiger ein ungünstiges Verhältnis zwischen Körperfett und Muskelmasse. Auch der Umgang mit Säuglingsernährung spielt eine Rolle: Überfütterung oder falsche Zusammensetzung der Nahrung können die Energiezufuhr dauerhaft erhöhen.
Mehrere Studien zeigen, dass Stillen einen schützenden Effekt gegenüber Übergewicht haben kann. Gestillte Kinder haben meist ein besser reguliertes Hunger- und Sättigungsgefühl und eine langsamere, physiologischere Gewichtsentwicklung. Natürlich ist Stillen nur einer von vielen Faktoren – und kein Garant gegen Übergewicht –, aber es kann einen positiven Beitrag leisten.
Umwelt- und verhaltensbezogene Faktoren
Neben genetischen und familiären Einflüssen spielen auch Umwelt- und Verhaltensfaktoren eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Übergewicht im Kindesalter. Unsere moderne Lebensweise hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert – mit tiefgreifenden Folgen für die Gesundheit von Kindern.

- Bewegungsmangel bzw. zu wenig körperliche Aktivität: Viele Kinder bewegen sich heute deutlich weniger als frühere Generationen. Schulwege werden häufiger mit dem Auto zurückgelegt, Freiflächen in Städten sind begrenzt, und Freizeit findet oft drinnen statt. Laut Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Kinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten täglich körperlich aktiv In der Realität erreichen jedoch viele Kinder dieses Ziel nicht annähernd. Der Bewegungsmangel wirkt sich gleich doppelt negativ aus: Zum einen werden weniger Kalorien verbrannt, zum anderen fehlen wichtige Reize für Muskeln, Knochen, Kreislauf und Stoffwechsel.
- Viel Bildschirmzeit/Mediennutzung: Digitale Medien gehören heute selbstverständlich zum Alltag, doch zu viel Bildschirmzeit erhöht das Risiko für Übergewicht deutlich. Kinder, die viele Stunden täglich vor Fernseher, Tablet oder Smartphone verbringen, bewegen sich nicht nur weniger, sondern essen auch häufiger unkontrolliert. Hinzu kommt, dass Kinder über Werbung gezielt mit ungesunden Lebensmitteln konfrontiert werden: Fast Food, Softdrinks oder Snacks mit hohem Zucker- und Fettgehalt. Diese Kombination – wenig Bewegung plus hohe Energiezufuhr – schafft ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und -verbrauch.
- Sozio-ökonomische Faktoren: Kinder aus Familien mit niedrigerem Bildungs- oder Einkommensniveau haben ein erhöhtes Risiko für Übergewicht. In Familien mit geringem Einkommen oder niedrigerem Bildungsgrad treten Übergewicht und Adipositas überproportional häufig
Diese sozioökonomischen Unterschiede zeigen: Übergewicht ist nicht allein ein individuelles Problem, sondern auch ein Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheiten. Kinder aus finanziell schwächeren Familien tragen ein höheres Risiko – nicht, weil sie weniger Disziplin haben, sondern weil ihre Umgebung weniger gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen bietet.
Welche Risikofaktoren gibt es bei übergewichtigen Kindern?
Gesundheitliche Risikofaktoren
Kinder mit Übergewicht oder Adipositas haben gegenüber normalgewichtigen Kindern ein erhöhtes Risiko für verschiedene Folgeerkrankungen:
- Herz-Kreislauf-Risiken: z.B. erhöhter Blutdruck, ungünstige Blutfettwerte.
- Stoffwechselprobleme: etwa Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, Fettleber.
- Orthopädische Beschwerden: Gelenk- und Bewegungssystem können belastet sein durch Übergewicht.
- Weitere Risiken: Schlafprobleme, erhöhte Entzündungsmarker, psychosomatische Beschwerden.
Psychische und soziale Risikofaktoren
Übergewicht und Adipositas wirken sich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und sozial stark auf Kinder und Jugendliche aus. Studien zeigen, dass übergewichtige Kinder häufiger unter psychischen Belastungen und einer eingeschränkten Lebensqualität leiden. Sie berichten über mehr somatoforme Beschwerden – also körperliche Symptome ohne organische Ursache, wie Bauch- oder Kopfschmerzen –, die oft Ausdruck von Stress, Scham oder emotionalem Druck sind. Zusätzlich treten Verhaltensprobleme, Rückzugstendenzen oder depressive Verstimmungen häufiger auf. Manche Kinder entwickeln auch Angststörungen, etwa im Zusammenhang mit sozialer Ablehnung oder schulischem Mobbing.
Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang in Untersuchungen, die den Einfluss von Übergewicht auf das Selbstbild analysieren: Kinder mit Adipositas bewerten ihr eigenes Aussehen häufiger negativ und erleben ein geringeres Selbstwertgefühl. Dabei bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede. Mädchen sind in vielen Studien stärker von psychosozialen Folgen betroffen als Jungen. Sie erleben häufiger Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, fühlen sich durch gesellschaftliche Schönheitsideale unter Druck gesetzt und reagieren sensibler auf ablehnende Kommentare über ihr Aussehen. Bei Jungen zeigt sich das Problem oft indirekter – etwa in Form von Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität oder Rückzug.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist der soziale Druck: Kinder mit Übergewicht werden im Alltag und insbesondere in der Schule oft stigmatisiert. Hänseleien, negative Zuschreibungen („faul“, „willensschwach“) oder auch subtile Ausgrenzung durch Gleichaltrige hinterlassen Spuren. Diese Erfahrungen führen nicht nur zu emotionalem Schmerz, sondern auch zu sozialem Rückzug – Kinder meiden Aktivitäten oder Kontakte aus Angst vor Ablehnung. Das kann einen Teufelskreis in Gang setzen: Weniger Bewegung, mehr Rückzug, Frustessen und sinkendes Selbstwertgefühl verstärken das Übergewicht weiter.
Ab wann ist ein Kind adipös (fettleibig)?
In Deutschland wird anhand der BMI-Perzentilen bei Kindern bewertet:
- Übergewicht: BMI-Perzentile > 90 bis 97.
- Adipositas (Fettleibigkeit): BMI-Perzentile > 97 bis etwa 99,5.
Das heißt: Ein Kind gilt als adipös, wenn sein BMI im Verhältnis zu Alter und Geschlecht deutlich in einem sehr hohen Bereich liegt – nicht nur „etwas zu viel Gewicht“, sondern eine ausgeprägtere Abweichung.
Folgeerkrankungen im Überblick
Zu den möglichen langfristigen gesundheitlichen Folgen von Übergewicht in der Kindheit zählen:
- Typ-2-Diabetes – auch bereits im Jugendalter zunehmend beobachtet.
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck, Arteriosklerose).
- Nicht-alkoholische Fettleber (NAFLD).
- Orthopädische Probleme – Gelenke, Knorpel, Bewegungsapparat.
- Psychische Beeinträchtigungen – z.B. verminderte Lebensqualität, depressive Symptome, Angststörungen.
Was können Eltern gegen das Übergewicht bei Kindern tun?
Eltern spielen eine zentrale Rolle – sowohl im Alltag als auch als Vorbild – wenn es darum geht, Übergewicht bei Kindern vorzubeugen oder zu behandeln. Hier drei wesentliche Bereiche: Ernährung, Bewegung und Prävention.

Ernährung
- Eine ausgewogene, altersgerechte Ernährung ist die Grundlage: Viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, weniger zucker-, fett- und salzreiche Snacks und Getränke.
- Mahlzeiten-Routinen helfen: feste Essenszeiten, möglichst gemeinsam essen, achtsames Essen („slow eating“) statt nebenbei Fernseh- oder Bildschirmzeit.
- Eltern als Vorbild: Wenn die ganze Familie gesunde Essgewohnheiten pflegt, sinkt das Risiko für Kinder, schlechte Ernährungsmuster zu entwickeln.
- Fokus nicht auf radikalen Diäten, sondern auf langfristigen, nachhaltigen Veränderungen in der Ess- und Lebensmittelumgebung.
- Auch sinnvoll: Kinder in die Auswahl und Zubereitung von Speisen einbinden, damit sie Selbstwirksamkeit entwickeln und Wissen über Ernährung erwerben.
Bewegung
- Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein Schlüsselelement: Mindestens eine Stunde Bewegung pro Tag wird z. B. empfohlen – am besten Spiel, Sport, Ausflüge im Freien.
- Vermeidung von langem Sitzen und exzessiver Mediennutzung: Kinder sollten nicht zu viele Stunden täglich passiv vor Bildschirm oder Handy verbringen.
- Familienaktivitäten fördern (z. B. Spaziergänge, Fahrradfahren, gemeinsames Schwimmen) – so wird Bewegung natürlich und positiv verknüpft.
- Schulen, Vereine und Gemeinschaftsangebote nutzen helfen – Eltern können Kinder unterstützen, sich dort zu engagieren.
- Wichtig: Freude an Bewegung schaffen, nicht erzwingen – Kinder sollen positive Erfahrungen mit Aktivität machen, damit sie langfristig dranbleiben.
Prävention
- Schon früh ansetzen: Je früher gesunde Gewohnheiten etabliert werden, desto besser. Kinder im Vorschul- und Grundschulalter profitieren besonders von gesunden Rahmenbedingungen.
- Regelmäßige ärztliche Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen – dort wird z.B. der BMI bzw. Perzentilkurven überprüft und Auffälligkeiten können früh erkannt werden.
- Kommunikation innerhalb der Familie: Offene Gespräche über Ernährung, Bewegung und Körpergefühl – Werte wie Gesundheit, Selbst-Akzeptanz und Wohlfühlen wertschätzen, nicht nur das Gewicht.
- Prävention ist besser als Therapie: Wenn Übergewicht bereits chronisch geworden ist, wird eine Umstellung oft schwerer. Daher ist das Ziel, dass Übergewicht gar nicht erst entsteht oder frühzeitig beeinflusst wird.
Fazit zu Übergewicht bei Kindern
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen sind komplexe, multifaktorielle Probleme – mit erheblichen gesundheitlichen und psychischen Risiken. Die Statistik zeigt: Auch in Deutschland ist das Thema angekommen und verlangt aktive Maßnahmen. Eltern, Familien, Schulen und Gesellschaft sind gleichermaßen gefordert. Wichtig ist: nicht Schuldzuweisungen, sondern Motivation und Unterstützung. Kinder sollen wachsen und sich gesund entwickeln – mit Wohlbefinden, Bewegung, guter Ernährung und einem stabilen Selbstwertgefühl. Bereits kleine Veränderungen im Alltag können große Wirkung entfalten – und eine nachhaltige Richtung vorgeben.
Quellen:
- https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/-/erstmals-mehr-kinder-und-jugendliche-weltweit-fettleibig-als-untergewichtig-/382412
- https://www.aok.de/pp/gg/update/unicef-uebergewicht/
- https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/praevention-von-kinder-uebergewicht
- https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/informationsdienst-baekground/detail/baek-fordert-gesetzliche-regelungen-im-kampf-gegen-kindliches-uebergewicht
- https://www.pebonline.de/peb-themen/uebergewichtadipositas/
- https://www.dak.de/dak/gesundheit/psychische-gesundheit/essstoerungen/uebergewicht-bei-kindern_46616